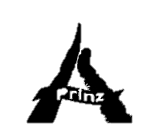|
|
Welpentraining
Das Welpentraining findet bei mir als Kombination
aus Spielgruppe, Gruppentraining in der Kleingruppe, Hausbesuch und
Theorievermittlung über Videos und Handouts statt
Anfrage Welpentraining Email
Anfrage Welpentraining WhatsApp: 0170 9047798
Im
Paketpreis (210€) enthalten ist:
· Ein
Hausbesuch zur Klärung aller Fragen der Anfangszeit (60 – 90 Min.)
(bei Wunsch auch Online / telefonisch)
· 7 x
Teilnahme an der momentan wöchentlich stattfindenden
Welpentrainingsgruppenstunde (Samstag) Kleingruppe; keine
Massenveranstaltung.
· 1 x
Stadttraining zur Umweltgewöhnung
· 10 x
Teilnahme an der Spielgruppe (im Moment Dienstagabend)
· Über 25
Schulungsvideos mit den wichtigsten Informationen und Trainingsanleitungen
· Rund 50
Theoriehandouts zu allen relevanten Themen (z.B. Stubenreinheit, Futter,
Schlafen, Alleinbleiben, Beißhemmung, „Welpenspinnen“, Parasitenschutz,
Bindungsspaziergang, sonstige Grundkommandos, Rückruf, Sitz, Platz,
Abbruchsignal, Schau-Übung, Leinenführigkeit, Schleppleinentraining,
Körperpflegeübungen, Umweltgewöhnung, wichtige Infos für die Welpenzeit,
richtiges Spielen, Gerätearbeit, Clickertraining…)
· Möglichkeit,
jederzeit schriftlich (WhatsApp / Email)und während der Gruppenstunden Fragen
zu stellen – ich begleite Sie die komplette Welpenzeit!
Sie
sind der richtige Kunde für mich, wenn Sie sich gern spannendes Wissen rund
um das soziale Rudeltier Hund aneignen wollen und Freude daran haben, sich
mit dem Vierbeiner zu beschäftigen und ihn zu erziehen und zu trainieren.
Ich bin
der richtige Trainer für Sie, wenn Sie umfassende Hilfestellung in allen
Fragen rund um Ihren vierbeinigen Begleiter erwarten und ein methodisch
reichhaltiges Training unter Einbeziehung sowohl moderner Lerntheorie als
auch jahrzehntelanger Erfahrung mit dem komplexen Wesen Hund schätzen.
Wir
arbeiten spielerisch sowie motivations- und belohnungsbasiert aber auch
intensiv und mit angemessenen, fairen Grenzsetzungen für den Hund. Großer
Focus liegt auf guter Sozialisation und Umweltsicherheit sowie Arbeit an
Frustrationstoleranz und Impulskontrolle von Anfang an, um späteren Problemen
effektiv vorzubeugen.
Sie
müssen nicht die „Katze im Sack“ kaufen - die ersten 3 Einheiten zahlen Sie
direkt, dann entscheiden Sie sich, ob Sie das Restpaket buchen
Hier ein Video mit Ausschnitten aus den Lehr-Videos, damit Sie eine
Vorstellung haben: https://youtu.be/N11wPRqQyqc
Neu:
In meinem YouTube-Kanal finden Sie aktuell eine Videoreihe zum
Thema „Welpen-No-Gos“
Dinge, die man bei Welpen und jungen Hunden unbedingt vermeiden sollte,
um irgendwann einen gut erzogenen, gesunden, kompetenten Hund zu haben.
Schaun Sie doch mal rein und bekommen Sie einen ersten Eindruck von mir und
meiner Arbeitsweise: Welpen-No-Gos
- YouTube
Bis Ende Februar 24 werden immer wieder neue Videos aufgeschaltet, für alle
frei zugänglich!

Auch auf Facebook / Instagram finden Sie immer wieder aktuelle Bilder und Postings von
meinem Training.
|

|

|

|
|
Der Rückruf ist das wichtigste Kommando im Hundeleben, deshalb
ist ein solider, fehlerfreier Aufbau sehr wichtig. Hier kann man
tatsächlich viel falsch machen.
|
Gerätearbeit, die Gewöhnung an Farben, Formen, Untergründe und
unterschiedlichste Herausforderungen, schweißen das Hund-Mensch-Team
zusammen und fördern den Hund körperlich sowie mental.
|
Wir üben Futter abgeben, tauschen. Ein Hund sollte
beispielsweise gefundenes Fressbares auf Kommando auch wieder auslassen.
|
|

|

|

|
|
Spiel mit dem Mensch fördert die Bindung enorm, erleichtert
Lernvorgänge und gibt dem Hund eine Vorstellung davon, dass mit seinem
Mensch richtig viel Spaß möglich ist. So hat man später einen Hund, der
sich auch bei Anwesenheit anderer Hunde gern an seinem Mensch orientiert.
|
Sitz, Platz und Bleiben sind Klassiker, ein schrittweiser,
fehlerfreier Übungsaufbau aber wichtig.
|
Beim Hausbesuch klären wir alle Anfangsfragen und können auch
auf individuelle Herausforderungen eingehen, wie hier die Gewöhnung an
andere vorhandene Haustiere.
|
|

|

|

|
|
Motorikschulung auf wackeligen Untergründen sowie
Generalisierung von Grundkommandos.
|
Gewöhnung an Farben, Formen, Untergründe. Der Hund lernt, sich
selbst etwas zuzutrauen und auch seinem Menschen zu vertrauen.
|
Hier auch wieder Vertrauensarbeit. Eine wackelige Schubkarre
als Untergrund kann zu Anfang schon mal Angst machen, mit ruhiger Führung
und positiver Bestätigung lernt der Hund aber schnell, dass zusammen mit
seinem Mensch nichts Böses passiert.
|
|

|

|

|
|
Gewöhnung an Begegnungen des Straßenverkehrs. Man kann ein
Fahrrad in Ruhe vorbeifahren lassen, ohne zu kläffen, Angst zu haben oder
es zu verfolgen.
|
Arbeit unter verlockenden Ablenkungen. Futter, spannende
Gegenstände und Gerüche und dennoch bleibt die Aufmerksamkeit und der
Gehorsam beim Besitzer.
|
Gelegentlich möchten die Katzen ins Training einbezogen
werden. Das Angebot nehmen wir gerne an
.
|
|

|

|

|
|
Klassiker Rückruf. Und Impulskontrolle beim wartenden Hund,
der lernt, bewegte Reize und andere Hunde auch mal zu ignorieren.
|
Sitz und Platz. Bei Kälte machen wir es den Hunden gern mit
einer warmen Unterlage angenehm. Man muss das Lernen ja nicht mit
Vermeidbarem erschweren.
|
Leinenführigkeit. Viele Wege führen zum Ziel, das
zugegebenermaßen oft eine Herausforderung ist. Deshalb arbeiten wir auch
mit dem ganzen Methodenspektrum, immer auf den Hund angepasst.
|
|

|

|

|
|
Auch Maulkorbtraining gehört zu einer soliden Grundausbildung
dazu. Irgendwann kommt jeder in die Lage, mal einen Maulkorb zu brauchen,
sei es in der Seilbahn, öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Tierarzt ....
|
Gerätearbeit, Balancegefühl und Grundkommandos kann man
kombinieren.
|
Hund-Mensch-Spiel ist so wichtig. Wie es richtig geht, lernen
wir gemeinsam.
|
|
Bilder von der
Welpenspielgruppe
|
|

|

|

|

|
|

|

|

|

|
|

|

|

|

|
|

|

|

|

|
Ein
kleiner Auszug aus meinen Theorie-Handouts:
|
Umweltgewöhnung
Die
wichtigste Zeit im Leben eines Hundes ist die sogenannte sensible Phase. Hier
wird der Grundstein für die spätere „Alltagstauglichkeit“ des Vierbeiners
gelegt. In dieser Phase lernt der Welpe alles, was er braucht, um ein
soziales Lebewesen im wahrsten Sinne des Wortes zu werden. Er lernt die
Kommunikation zwischen Hunden und von Hund zu Mensch - und er lernt seine
Umwelt kennen. Dinge, die er jetzt nicht kennen lernt, werden in späteren
Begegnungen Angst auslösen. Das kann bis zu sogenannten Deprivationsschäden
gehen - dann haben wir Hunde, die zeitlebens verängstigt und irritiert auf
alles und jeden reagieren, denn Deprivation ist nicht rückgängig zu machen
- das entsprechende Entwicklungsfenster hat sich bereits geschlossen.
Der
Welpe lernt in dieser Phase auch ganz generell, mit Emotionen wie Angst
oder Freude umzugehen und er übt seine Frustrationstoleranz. Diese Phase
dauert ca. von der 4. bis zur 18. (andere Quellen: 14.) Lebenswoche; starke
rasseabhängige Unterschiede wurden festgestellt, zudem dürfte sie fließend
auslaufen.
Dem
Züchter und später eben auch dem
neuen Welpenbesitzer kommt insofern eine ganz große Verantwortung
zu, dem Welpen in dieser Zeit den nötigen Input zu bieten, ohne ihn
allerdings zu überfordern, denn positiv abgespeichert können diese ganzen
Umweltreize ja nur werden, wenn sich der Hund dabei in einem insgesamt
positiven emotionalen Zustand befindet, nicht verängstigt, gestresst oder
überfordert ist. Gerade Welpen, die bislang wenige Umwelterfahrungen machen
konnten, sind gefährdet, bei zu vielen plötzlichen neuen Reizen diese in
der daraus resultierenden Stresssituation erst recht negativ abzuspeichern.
Damit ist dann leider gar nichts gewonnen, im Gegenteil. Die
Umweltgewöhnung muss also immer auf den individuellen Hund abgestimmt
werden, was viel Fingerspitzengefühl erfordert. Ausreichend Ruhephasen mit
echter Entspannung sind elementar wichtig sowohl für Aufnahmefähigkeit als
auch Abspeichern der neuen Erfahrungen. Jederzeit darf der Welpe vom
Besitzer bei solchen Erfahrungen auch getragen werden, wenn er so
entspannter und eben auch körperlich nicht überfordert wird. Der
Mensch-Hund-Bindung kann es ebenfalls nur gut tun, dem Welpen auch
körperlich als sicherer Hafen zu dienen.
Nun
einige Empfehlungen, was alles in der sensiblen Phase kennen gelernt werden
sollte:
• positiver Kontakt mit unterschiedlichen
Hunden
sowohl
vom Alter, der Größe als auch der Optik her. Langschnäuzige Rassen sollten
kurzschnäuzige kennen lernen und umgekehrt. Gerade diese unterschiedliche
Mimik und Körpersprache führt sonst oft zu Verwirrungen.
• Unterschiedliche Menschen
Hier
ebenfalls Alte, Junge, Kleinkinder, Menschen auf Krücken oder im Rollstuhl,
mit Hut, Bart, Mantel oder anderer Hautfarbe, Dicke und Dünne, Laute und
Leise...
Einzelne
Menschen und Menschengruppen, vielleicht auch mal an der Grundschule oder
am Kindergarten vorbei gehen. Der Hund muss sich nicht von jedem anfassen
lassen, aber eine freundliche Kontaktaufnahme mit Schnuppern an der Hand
sollte möglich sein.
Bitte
den Welpen mit Kindern nicht allein lassen - zu schnell macht der Hund
unangenehme Erfahrungen bei übergriffigen oder hundeunerfahrenen Kindern.
Und dann besteht natürlich auch immer eine Gefahr für die Kinder.
Einen
Hund von anderen Menschen fern zu halten, damit die eigene Bindung zu ihm
besser wird, ist Schwachsinn. Wie ärmlich, wenn man das nur so schafft.....
• andere Tiere
Lernt
ein Hund früh Kleintiere wie Hase, Meerschwein, Katze etc. entspannt
kennen, kann das verhindern, dass diese irgendwann ins Beuteschema fallen.
Große Tiere wie Kühe, Pferde, Esel etc. rufen oft eher Angst hervor. Eine
gesunde Vorsicht vor diesen ist für Hunde auch durchaus angebracht, aber
panisches Verhalten lässt sich eben auch mit frühem Kontakt unter Einüben
von Verhaltensregeln in deren Anwesenheit vermeiden (kein Jagen, Verbellen,
Anknurren, ausreichend Distanz etc.). Immer mal wieder einen Zoo oder
Tierpark aufzusuchen kann auch hilfreich sein.
• städtische Umgebung mit verschiedensten
Fortbewegungsmitteln, Kaufhäuser, Aufzüge (keine Rolltreppe!
Brandgefährlich für Hundepfoten!), Bahnhöfe, Busfahrt, Baumarkt...
• Untergründe
Nicht
nur natürliche Untergründe wie Wiese, Sand, Waldboden, Wasser (! dürfen
Welpen Wasser positiv kennen lernen, schwimmen sie später meist auch gern),
Treppen (nicht übertreiben wegen Gelenkwachstum), Teppich, rutschige Böden
(zu Hause vermeiden ebenfalls wegen der Gelenkentwicklung), Durchsichtiges
wie Gitterböden oder Glas...). Auch das bekannte Bällebad fällt in diese
Kategorie.
• Geräusche
Einige
Rassen neigen besonders zur Entwicklung von Geräuschempfindlichkeit.
Darunter fallen z.B. die Hütehunde. Gezieltes Gewöhnen an Geräusche in
positiv besetzten Situationen (Spiel, Fressen, Schmusen) und in
angemessener Lautstärke und Dauer kann Sinn machen. Auch durchaus zu Hause
einen geräuschvollen Umgang pflegen, immer angepasst an das Verhalten des
Hundes. Also Geschirrklappern, Staubsaugen, Türe mal zuschlagen, nicht
immer nur leise und rücksichtsvoll sein. Auch das öftere Abspielen einer
Geräusch-CD kann hilfreich sein. Achtung: beim ersten Silvester des Hundes
diesen eher abschirmen. NICHT nach draußen lassen beim Feuerwerk, ruhiges
Zimmer anbieten, nicht allein lassen. Silvester ist eigentlich fast immer
too much und ich kenne nicht wenige Hunde, die - vor Silvester schussfest -
nach Silvester wegen der massiven Überforderung mit Knallgeräuschen ihre
Schussfestigkeit verloren hatten.
• medizinische Vorsorge
Die
Körperkontrolle, das Anfassen an den Pfoten, die Begutachtung und Reinigen
der Ohren, Zähne zeigen, Maul öffnen – das sind alles Dinge, an die sich
ein Hund gewöhnen kann und sollte. Auch Krallen schneiden und bei
entsprechenden Rassen das laufende Schergerät. Auch den Tierarzt mal ohne
Grund aufsuchen, einfach ein Weilchen im Wartezimmer sitzen...
• Prägung auf unterschiedliche
Futterarten.
Der
Welpe soll durchaus verschiedene Futtererlebnisse erhalten; auch eine
vielfältige Darmflora kann sich am besten ausbilden, wenn das Futterangebot
abwechslungsreich ist. Trockenfutter, Feuchtfutter, evtl. auch mal
Rohfleisch, unterschiedliche Fleisch-, Getreide-, Gemüsesorten. Allerdings
auch hierbei nicht übertreiben - es kann bei späteren Allergikern sehr
hilfreich sein, wenn sie exotische Fleisch- und Getreidesorten noch nie
probiert haben, diese können dann eben oft noch verfüttert werden.
• Urlaub
Ihr
könnt euren Welpen durchaus auch mit in den Urlaub nehmen.
Tollwutimpfpflicht beim Grenzübergang beachten (15 Wochen Mindestalter). In
Hotel /Pension / FeWo müsst ihr selbst abschätzen, ob die Stubenreinheit
schon so weit gediehen ist, dass dies möglich ist, und ob ihr den Welpen
dort möglichst nie allein lassen müsst. Campingurlaub mit Welpe ist meist
relativ unkompliziert, man muss aber aufpassen, dass man den Hund mit dem
ständigen Input nicht überfordert und er auch im Urlaub ausreichend zur Ruhe
kommt. Autofahren bitte vorher üben.
Der Welpe sollte die Autofahrt stressfrei mitmachen können.
Achtung:
das ist keine To-Do-Liste, die abgearbeitet werden muss. Damit wären wir
sicher bei den meisten Hunden wieder in der schädlichen Überforderung. Die
Liste soll lediglich als Anregung diesen - was man tatsächlich durchführt,
wird sich auch immer an den später geplanten Lebensumständen des Hundes
orientieren müssen.
|
|
Wie
der Welpe die Beißhemmung erlernt
Die
Hemmung, seinen Sozialpartner im Spiel oder bei Auseinandersetzungen durch
Zubeißen ernsthaft zu verletzen, ist nicht, wie vielfach behauptet wird,
angeboren, sondern sie muss im Spiel mit den Sozialpartnern erlernt werden.
Die
Beißhemmung gegenüber Hunden lernen Welpen am besten im Umgang und im Spiel
mit Altersgenossen und anderen, sozial sicheren Hunden - hierzu sollten sie
insofern regelmäßig Gelegenheit haben.
Die
Beißhemmung gegenüber Menschen lernt der Welpe im Spiel mit seinen
Bezugspersonen. Und dazu muss man mit dem Welpen Beißspiele spielen!
Der
Welpe darf zunächst in Hände und Arme beißen. Wenn er zu wild wird und zu
heftig zubeißt, wird das Spiel abgebrochen ( spitze Welpenzähne tun
naturgemäß auch bei relativ sanftem Beißen etwas weh ). Beißt er trotzdem
weiter, so stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung:
So
kann man einfach aus dem Zimmer gehen.
Auch
über-den-Fang-Greifen – der Schnauzengriff, den viele Welpen noch von ihrer
Mutter kennen - kann, korrekt eingesetzt, Grenzen setzen. Ein helles
Quietschen („Au“) kann beim Welpen dasselbe Verhalten auslösen wie das
Jaulen hundlicher Spielgenossen - er unterbricht sein Beißen.
Man
darf auch durchaus mit einem stimmlichen Abbruchkommando einwirken (auch
Hunde untereinander werden "pampig" oder tun durch Knurren kund,
dass es jetzt einfach einen Tick zu viel war), dabei aber nicht zu heftig
schimpfen oder strafen, denn manche Welpen werden hierdurch evtl. nur noch
wilder (besonders beim klassischen „Welpenspinnen“, das häufig in einer
Situation genereller Überreiztheit gezeigt wird – hier ist eine kurze
Auszeit in der Hundebox oder einem abgegrenzten Bereich oft die beste
Lösung) oder sie bekommen Angst, vielleicht weil das Timing nicht genau
genug war und sie nicht verstehen können, wofür sie bestraft wurden.
Da
jeder Hund, auch bereits jeder Welpe, anders ist, einen ganz eigenen
Charakter hat, nutzt man aus diesen Methoden einfach diejenige, die sich
als erfolgreich herausstellt, mit der sich Hund und Hundehalter am wohlsten
fühlen. Ist man unsicher, welche Reaktion angemessen ist, macht es Sinn,
mal einen Trainer oder eine sonst erfahrene Person über die Situationen
drüberschaun zu lassen.
Sobald
der Welpe sich wieder beruhigt hat, kann er erneut zum Spiel aufgefordert
werden.
Im
Laufe der nächsten Wochen wird der Welpe lernen, welcher Zahneinsatz von
seinem Besitzer toleriert wird und was zu viel ist. Hier kann jeder
Besitzer – abgestimmt auf seine Vorstellungen und das Temperament seines
Hundes – eigene Grenzen setzen. Für das eine Hund-Mensch-Team sind
körperliche Spiele weiterhin ein Highlight im gemeinsamen Zusammenleben,
beim anderen eben unerwünscht, weil vielleicht nicht zu Halter und Hund
passend. In diesem Fall sollte man das Spiel einfach immer früher
unterbrechen, wenn der Hund seine Zähne auf Kleidern und Haut einsetzt,
auch wenn es keine Schmerzen verursacht.
Mit
dem Zahnwechsel sollte das Erlernen der Beißhemmung ungefähr abgeschlossen
sein.
|
|
Richtig
spielen mit unseren Hunden
Spielen
macht Mensch und Hund Spaß, stärkt die Bindung, fördert das gegenseitige
Vertrauen und trainiert bei Welpen und Junghunden die Beißhemmung.
Was
ist gutes Spiel?
Menschen
denken bei Spiel mit Hunden oft als erstes ans Bällchenspiel. Aber das
bringt so einige Nachteile mit sich:
Besonders bei Hunden im Wachstum belasten die ständigen Stopps
Bänder, Gelenke und Sehnen; im schlimmsten Fall kann es zu Schäden kommen,
die sich erst Jahre später bemerkbar machen. Beim monotonen Ballwerfen
werden zudem Elemente aus dem Jagdverhalten herausgegriffen und immer und
immer wieder eingeübt; ein Hund mit jagdlicher Tendenz wird so geradezu zum
Jäger erzogen; wenn man Pech hat, generalisiert der Hund dieses
Hinterherhetzen hinter bewegten Objekten zudem auf alle möglichen Dinge,
von Wild über die Nachbarskatze bis hin zu Radlern, Joggern, Autos. Dann
wird es richtig gefährlich. So mancher Hund mutiert zudem regelrecht zum
Junkie - wenn sein Mensch das Bällchen einsteckt, interessiert nichts
anderes mehr. Bei jedem geworfenen Ball kommt es zu Ausschüttung von
Stresshormonen, das Hinterherhetzen ist zudem selbstbelohnend, führt zur
Dopaminausschüttung. Ein Suchtkreislauf beginnt. Beim Bällchenspiel findet
der Spaß für den Hund zudem immer weit entfernt vom Menschen statt.
Ziemlich anonym, das hat nichts mehr zu tun mit bindungsfördernder
Beschäftigung.
Echtes,
„gutes“ Spiel ist gekennzeichnet durch einen ständigen Wechsel von
Verhaltensweisen, die im hundlichen Alltag ebenfalls vorkommen. Beißen,
Zerren, Suchen, Hinterherrennen, Verfolgtwerden, mit der Beute Davonlaufen,
Balgen, Rangeln, ein ständiger Rollenwechsel, auch zärtlicher
Körperkontakt.
Es
bietet sich hierzu besonders das Spiel mit einem Objekt an, in das der Hund
beißen darf, an dem er zerren kann. Ein Objektspiel also, wie es auch unter
Hunden beobachtet werden kann und welches Hunde oft auch mal allein
spielen. Selbstverständlich kann auch ohne Objekt, nur unter Einsatz des
eigenen Körpers gespielt werden und es ist durchaus hilfreich, das immer
wieder mal zu tun, erfahrungsgemäß tun sich hiermit viele Menschen ziemlich
schwer. Mit einem geeigneten Spielzeug können aber auch verständige Kinder
nach entsprechender Anleitung und unter Aufsicht gut mit dem Hund spielen.
Zudem kann der Hund seine Zähne einsetzen, was seinem ursprünglichen
Spielverhalten entspricht.
Es
eignen sich alte Socken, ein Stofflappen, handelsübliche Zerrseile oder
ausrangierte Kuscheltiere. Es macht Sinn, DAS Lieblingsspielzeug nicht
immer herumliegen zu lassen, sondern nur zu den Spielstunden
hervorzuzaubern. Dem Hund wird so klar, dass der Mensch über diese
wertvolle, tolle Ressource verfügt, zudem bleibt das Spielzeug so
attraktiver.
Vermeiden
sollte man, den Hund am Spielzeug herumzuschleudern, zu heftige Bewegungen
zu machen, die Wirbelsäule oder Zähne belasten. Vorsicht besonders im
Zahnwechsel ab der 16. Woche – hier kann das an sich lustvolle Spiel sonst
schnell schmerzhaft für den Hund werden. Auch emotional sollte man den Hund
nicht unangemessen hoch pushen, Vorsicht bei leicht erregbaren Hunden!
Wie beginnt
man?
Man
macht den Hund durch schnelle, „zappelnde“ Bewegungen des Spielzeugs auf
dem Boden aufmerksam, wie eine Beute, die sich vom Hund wegbewegt. Hat man
das Interesse soweit geweckt, dass der Hund einbeißt, bringt man seine
Freude und seinen Spaß darüber zum Ausdruck und bewegt das Spielzeug gerade
so stark hin und her, dass der Hund nicht wieder loslässt.
Wir
können mit dem Spielzeug auch mal davonrennen, es verstecken – entweder
unter unseren Beinen oder auch mal unter nahe liegenden Möbelstücken, wir können mit dem Hund beim Zergeln
herumbalgen, ihn an allen Körperstellen berühren, mit den Händen die
Schnauze spielerisch umgreifen, mal den Hund auf den Boden legen und ihn
anschließend über uns drüber krabbeln lassen. Ein ständiger Rollenwechsel
kennzeichnet gutes Spiel und ist auch bei Hunden untereinander zu beobachten.
Es macht flexibel und schult das schnelle Einstellen auf neue,
unterschiedliche Situationen.
Jeder
darf mal "gewinnen", sprich das Spielzeug erbeuten. Ein Hund, der
sein Spielzeug triumphierend davon trägt, ist nicht dominant, sondern hat
gerade jede Menge Spaß! Auch Hundeeltern beharren nicht immer auf ihrer
Position und lassen auch schon einmal die Jungspunde gewinnen.
Allerdings
sollte der Hund sich gut kontrollieren lernen. Dreht er zu stark hoch, wird
das Spiel unterbrochen und erst neu begonnen, wenn Ruhe eingekehrt ist.
Auch das Auslassen des Gegenstandes sollte immer wieder einfließen. Hierzu
einfach den Gegenstand aus der Schnauze nehmen – nicht herausreißen,
sondern mit einem ernst ausgesprochenen Kommando aus der Schnauze nehmen,
evtl. die Schnauze von oben öffnen. Dann ist kurz Pause, den Hund mit der
anderen Hand blockieren, bis er versteht, dass er Innehalten soll und sich
zurücknimmt. Nun kann das lustvolle Spiel neu beginnen. Hier üben wir
Impulskontrolle, Frustrationstoleranz und eben auch Gehorsam sowie
Achtsamkeit auf die Signale des Menschen – es geht nur weiter, wenn der
Hund sich zurücknimmt.
Viele
Hunde knurren beim Spielen. Dieses Spielknurren unterscheidet sich deutlich
von ernst gemeintem Knurren und ist vollkommen normal. Es muss nicht
unterbunden werden, man braucht auch nicht weiter darauf einzugehen.
Immer
mit dem Spiel aufhören, solange es beiden Parteien noch Spaß macht. Und
nicht jeder Tag ist ein guter Tag für’s Spielen – wenn eine der Parteien
nicht dazu aufgelegt ist, lässt man es am besten.
Wenn
Menschen während des Spiels mit ihrem Hund sprachlich und stimmlich ihre
Freude und ihren Spaß zum Ausdruck bringen, fördert dies die hundliche
Spielbereitschaft.
Was
bringt’s?
Bei
Hunden untereinander gilt die Regel: wer sich im Spiel unfair verhält,
indem er beispielsweise zu stark zwickt, für den findet sich bald kein
Spielpartner mehr. Also heißt es, sich selbst zu zügeln und fair zu
spielen. Spiel hat also viele Funktionen: motorische, kognitive und
soziale. Auch das können wir imitieren, um unseren Hunden Lernerfahrungen
zu ermöglichen.
Beim
Spiel mit ihren Menschen spielen Hunde aber anders als mit ihren
vierbeinigen Kumpels: So lassen sie einen Gegenstand schneller liegen,
geben ihn ab, sind also weniger wettbewerbsorientiert als untereinander.
Hunde, die viel mit ihren Menschen spielen, sind im Alltag viel
ausge¬glichener und sogar leichter händelbar.
Forscher
maßen bei Hunden vor und nach dem Spiel mit Menschen die
Cortisolkonzentration im Blut: Nur bei entspanntem Spiel mit Ermunterungen
und zärtlichen Berührungen nahm die Cortisolkonzentration ab. Cortisol wird
auch als Stresshormon bezeichnet und in aggressiv-aufgeheizten Situationen
ausgeschüttet, vor allem aber dann, wenn eine Situation unkontrollierbar
oder unklar erscheint. Lernen geht leichter, wenn man Spaß dabei hat, das
gilt auch für unsere Vierbeiner: Im Spiel lernen sie uns Menschen genauer
und unmittelbarer kennen. Sie lernen, auf uns zu achten und einzugehen.
Spiel
hilft ¬generell, mit Frust besser umzugehen, ein besseres
Problem¬löseverhalten an den Tag zu legen, sich anzupassen und
¬Selbstvertrauen zu entwickeln. Kooperation und Fairness werden in keinem
anderen Lebensbereich so unmittelbar erlernt wie im Sozialspiel.
Bei
Mensch und Hund wird während des gemeinsamen Zusammenseins zudem ein ganz
wichtiges Hormon ausgeschüttet: das Oxytocin, das auch als
„Bindungshormon" bekannt ist. Und wenn man sich in der Nähe eines
Lebewesens wohl fühlt, ist man auch gerne bei ihm – nicht nur während des
Spiels, sondern in allen Lebenslagen. Vierbeiner, die ausgiebig mit
Menschen spielen dürfen, kommen sogar besser mit einer kurzzeitigen
Trennung zurecht. Während des Spiels erfahren Hunde die Verlässlichkeit des
Sozialpartners Mensch. Sie erlernen eine gesunde Neugier und erleben auch
kurze Momente des Frusts: all das verhindert in den meisten Fällen das
Entstehen von Trennungsängsten. Außerdem merken Hunde während des Spiels,
dass es ihr Verhalten ist, mit dem sie eine Situation beeinflussen können.
Dies macht sie insgesamt selbstsicherer und gelassener, ja optimistischer,
was der Beziehung Mensch-Hund nur gut tun kann.
Sehr
interessant ist auch eine neuere Studie von Nadja Affenzeller, laut der
Spiel zum Abschluss einer Training- und Lernsituation das Gelernte sehr
viel besser im Gedächtnis verankert, die Lernkurve merkbar steiler macht.
Bei Interesse einfach mal googeln!
|
|
Den
Welpen sehen
Wenn
der Welpe zu uns ins Haus kommt, ist alles neu für ihn. Geschwistern, Mama
und bisherige Bezugspersonen fehlen plötzlich schmerzhaft, eine riesige
Verunsicherung ist an deren Stelle getreten. Eine neue Beziehung,
idealerweise Bindung soll entstehen und wird vom Welpen auch verzweifelt
gesucht; kein anderes Säugetier ist zu so intensiven Bindungen zum Menschen
fähig wie der Hund. Bis zum Alter von ca. 16 / 18 Wochen haben kleine Hunde
einen natürlichen Folgetrieb, der dem Selbstschutz dient. Sie wollen ihre
Bezugspersonen beim Spaziergang nicht verlieren, denn für einen so kleinen
Welpen bedeutet ein Verlust in fremder Umgebung in der freien Natur in der
Regel den Tod. So haben Welpen in diesem Alter meist eine wunderbare
Orientierung am Menschen, laufen diesem nach, schauen diesen an, suchen
Körperkontakt. Leider kommt von uns aber oft kein Feedback. Der Mensch
sieht es als eine Art Selbstverständlichkeit und lässt die Chance, in
dieser Phase eine intensive Bindung und Orientierung aufzubauen, ungenutzt.
Hunde untereinander reagieren nicht so stumpf. Sie antworten mit
Fellwittern, Anstupsen, Blickkontakt, Zuwendung….
Es
geht nicht um ständige Leckerchengabe, wobei auch das selbstverständlich
mal sein darf. Es geht um Feedback, ums Gesehenwerden. Warum gehen wir
nicht bei Aufmerksamkeit und Blickkontakt mal kurz zum Welpen in die Hocke,
streicheln und loben ihn, machen ein kurzes Spiel, lächeln ihn an?
Das
bedeutet nun aber wiederum absolut nicht, den Welpen ständig zuzuquatschen.
Im Gegenteil solltet ihr beim Spaziergang ziemlich wortlos die Richtung
wechseln, den Welpen auch nicht ständig rufen, denn er soll ja lernen, sich
an euch zu orientieren und nicht den Eindruck bekommen, dass ihr euch schon
meldet, wenn die Entfernung zu groß wird. So lernt der Hund, dass er auf
euch achten muss, um nicht verloren zu gehen, aber auch – ganz wichtig –
dass sich Kontakthalten für ihn lohnt.
Macht
er nicht diese Erfahrung, habt ihr irgendwann einen Hund, der beim
Aussteigen aus dem Auto Tschüss zu euch sagt und sein Ding macht, er wird
immer mehr eigene Wege gehen – was unweigerlich sowieso passiert, wenn er
dann in die Pubertät kommt. Denn wenn ihr bis dahin das freiwillige
Kontakt- und Anschlusshalten ignoriert habt, gibt es erst recht keinen
Grund für den Hund, eure Nähe zu suchen und wertzuschätzen.
Natürlich
zeigen unterschiedliche Rassen schon als Welpe dieses Verhalten
unterschiedlich stark. Der selbständig handelnde Jagdhund oder
Herdenschutzhund wohl weniger als ein Gesellschafts- oder Hütehund. Aber
zeigen tun sie es alle.
Sehr
schade, wenn man dieses Angebot des Welpen, diese wunderbare Möglichkeit
eines Bindungsaufbaus in diesem Alter verpuffen lässt – denn was sich nicht
lohnt, was nicht gesehen und beantwortet wird, wird der Hund irgendwann
bleiben lassen. Beim erwachsenen Hund das Anschluss- und Kontakthalten
später wiederaufzubauen, ist um einiges aufwändiger und mühsamer!
Also:
SEHT eure Welpen!
|
|
Social
Support
„Die
machen das schon unter sich aus“, „einen Hund, der Angst hat, soll man
nicht streicheln oder trösten, um die Angst nicht zu verstärken“, „da muss
er durch, damit er das lernt“…. Solche Sätze haben wir Hundehalter alle
schon gehört und fühlen uns dadurch vielleicht verunsichert, unseren
Impulsen und unserem Bauchgefühl zu folgen, das uns etwas anderes sagt.
Deshalb gleich vorweg: das ist alles Unsinn und zwischenzeitlich überholt
und widerlegt. Wir sind die Bezugspunkte für unsere Hunde und haben für ihre
Sicherheit zu sorgen, wie sollen sie uns sonst als Vertrauensperson
ansehen?
In
Hundebegegnungen auf ein „das machen die schon unter sich aus“ zu vertrauen
kann fatal sein. Sehr leicht erzieht man sich mit unguten Spielsituationen
einen Mobber, einen Hund, der gelernt hat, zügig und aggressiv in die
Offensive zu gehen, denn Schutz hat ihm ja bislang niemand geboten, oder
eben einen ängstlichen Kontaktverweigerer. Nicht falsch verstehen: Hunde
können und dürfen auch mal was selber regeln, wenn sie das selber möchten
und sich trauen, auch das sind Lernerfahrungen, die das Selbstbewusstsein
stärken. Aber nicht, wenn das Kräfteverhältnis zu ungleich ist, wenn
mehrere sich zusammen auf einen einzelnen fokussieren oder wenn einzelne
deutlich durch Körpersprache zum Ausdruck bringen, dass sie die Situation
überfordert sind oder eben auch besonders nicht, wenn der Hund zum Besitzer
kommt um dort Schutz zu suchen. Wer schickt denn sein Kind, das auf dem
Spielplatz verkloppt wird, wieder weg, wenn es weinend angelaufen kommt?
Oder wer schaut denn bitte untätig dabei zu? Dass es keinen sogenannten
„Welpenschutz“ gibt, ist hoffentlich auch inzwischen klar – also bitte
nicht auf die Freundlichkeit erwachsener Hunde gegenüber dem eigenen Welpen
vertrauen, auch das kann böse enden.
Auch
in sonstigen stressigen, angstmachenden Situationen ist Ignorieren nicht
das Mittel der Wahl. Tut lieber das, was euer Gefühl euch vorgibt:
Streicheln, Körperkontakt, Beruhigen. Ignorieren ist schlichtweg unsozial.
Die moderne Verhaltensbiologie bestätigt, dass soziale Unterstützung eines
der Kriterien für kooperatives Verhalten in Gruppen ist. Menschen zeigen
dieses Verhalten, aber auch viele Tiere, die in Gruppen leben, sind dazu
fähig, geben und holen sich Social Support. Social Support bedeutet, Gruppenmitgliedern
in stressenden Situationen durch körperliche Nähe und Zuwendung zu helfen.
Dies senkt Blutdruck, Herzfrequenz und den Spiegel der Stresshormone und
hilft, beängstigende Situationen besser zu bewältigen. Würde Social Support
zu einer Verschlimmerung von Angstzuständen führen, hätte sich dieses
sozio-positive Verhalten im Verlauf der Entwicklungsgeschichte nicht
erhalten können! Keine Gruppe kann es brauchen, dass ihre Mitglieder immer
ängstlicher werden. Hundehalter sollten sich deshalb am Wissen über
Sozialverhalten orientieren und ihren Tieren ausreichend Social Support
geben. Alles, was den Hund wirklich entspannt, ist Social Support und damit
erlaubt. Ignorieren oder gar Wegschicken beschädigen die Beziehung zwischen
Mensch und Hund und steigern die Angst des Hundes. Das heißt nun natürlich
nicht, den Hund zu bemitleiden oder mit Daueraufmerksamkeit zu
überschütten. Seid einfach für ihn da, beruhigt ihn und bietet ihm Nähe und
Körperkontakt, wenn er das möchte. Wichtig allerdings ist, in der Situation
selber ruhig und entspannt zu sein. Sonst kommt es womöglich zur
gefürchteten Stimmungsübertragung und der Hund reagiert künftig noch
stärker auf den jeweiligen Auslöser, der ja auch euch offensichtlich Angst
gemacht hat.
Für
Welpen- und Junghundebesitzer interessant ist auch, dass es sogenannte
„Spooky periods“ gibt, sogenannte Fremdelphasen, in denen für den jungen
Hund bislang Bekanntes, Unproblematisches plötzlich regelrechte Ängste
hervorruft. Diese liegen ca. in der 8. /9. Woche, bei 4. / 5. Monaten, und
dann nochmal bei ca. 9 Monaten, bei spät reifenden Hunden auch deutlich
später. Plötzlich zeigt sich der Hund schreckhaft, ängstlich, misstrauisch
allem Neuem gegenüber. Wie soll man sich nun während dieser Phasen verhalten?
Hierzu ein paar Tipps:
1.)
Sparsam mit neuen Reizen sein – es reicht, wenn sich der Hund in diesen
Phasen mit dem bislang schon Bekannten auseinander setzt.
2.)
kein großes Aufhebens von derartigen Situationen machen
3.)
Schreckendes in Ruhe und im eigenen Tempo untersuchen lassen, Zeit geben,
hilfreich ist „do as I do“, d.h. Untersuchen vormachen und deutlich zeigen,
dass der Gegenstand ungefährlich ist. Tiefes Ausatmen hilft hierbei.
Und
noch ein paar Hinweise, die helfen können, das so häufig bei Hunden zu
beobachtende Leinenpöbeln von Anfang an zu vermeiden, hierzu auch erst mal
ein bisschen Hintergrundtheorie:
Allen
sozial lebenden Tierarten gemeinsam ist: Wer sich in der Mitte befindet,
hat die größtmöglichen Chancen zu überleben. In der Mitte ist die
Sicherheit am größten. Jungtiere werden von den Älteren eingekreist,
Schwächere von Starken. Wer außen ist, steht sozusagen Auge in Auge mit der
Gefahr. Außen ist der Bereich der Verteidigung und damit der Platz derer,
die für Sicherheit zuständig sind.
Hunde
spüren instinktiv die Gefahr (oder Verantwortung), die eine Position außen
mit sich bringt und haben daher die Tendenz, nach innen zu kommen - oder
eben das "innen" nach außen zu verteidigen. In einer
Zweierbeziehung sieht das so aus, dass der Hund versucht, bei seinem
Menschen zu sein, oder aber, er versucht, den Menschen, wenn dieser
"innen" ist, nach außen zu verteidigen.
Wenn
unsere Hunde mit uns unterwegs sind, haben sie weit überwiegend die
Tendenz, vor uns zu laufen – also außen. Kein Wunder, dass sie sich in der
Pflicht fühlen, Dinge zu regeln: Territorium verteidigen, Besitzer
schützen, sich selbst schützen, dem Gegner verstehen zu geben, dass er
verschwinden soll…
Somit
ist der Lösungsansatz klar: Der Hund gehört nach „innen“, idealerweise
bevor er zu pöbeln beginnt bzw. sogar Angst zu haben oder bevor er sich in
der Verantwortung fühlt. Am besten hinter den Hundeführer, evtl. auf die
dem anderen Hund abgewandte Seite. Um dem Hund klar zu machen, dass man
draußen die Situation im Griff hat, sollte man aber auch in sonstigen
Alltagssituationen deutlich machen, dass man die Entscheidungen trifft und
auch die nötige Macht hat, sie durchzusetzen. Dazu bedarf es im täglichen
Zusammenleben einer gehörigen Portion Konsequenz und bewussten Handelns.
Wir sind dann beim bekannten Thema „wer bewegt wen“ im Alltag. Wer gibt die
Handlungsanweisungen, wer leistet Folge. Auch die Persönlichkeit spielt
eine Rolle: Wer keine Freude am Führen hat, wird meist von seinem Hund
geführt.
|
|
Warum
sollen Welpen mit Welpen spielen dürfen?
Wer
das Wort „Welpen“ in der Überschrift durch „Kinder“ ersetzt, spürt bereits
die Unsinnigkeit dieser Frage, denn die Antwort liegt auf der Hand: Weil
sie als soziale Wesen Kontakt zu Ihresgleichen brauchen, um zu lernen, zu
reifen und zu wachsen. Die Coronakrise zeigt(e), wie sehr Kinder und auch
Jugendliche leiden, wenn plötzlich der Sozialkontakt zur eigenen
Altersgruppe völlig wegfällt, wenn nur noch Erwachsene des eigenen
Haushalts als Sozialpartner zur Verfügung stehen.
Zum
Glück reifen unsere Kinder langsam, über Jahre, und werden das wochenlang
Versäumte hoffentlich schnell wieder wett machen. Bei Welpen ist das
anders, die sensible Phase, in der sie extrem lernfähig sind, ist schnell
vorüber und Versäumtes dann oft nicht mehr nachzuholen.
In
der sogenannten Sozialisierungsphase von der 3. bis ca. zur 18. / 20.
Lebenswoche finden zahlreiche neurologische Verknüpfungen im Gehirn des
jungen Hundes statt. In dieser Zeit wird nicht nur das Referenzsystem für
Bekanntes und Unbekanntes angelegt, auch die meisten sozialen
Verhaltensweisen werden eingeübt und verfeinert. Die meisten Welpen hatten
im Wurf Geschwister um sich und konnten in der Interaktion mit ihnen
bereits wichtige Sozialisierungserfahrungen machen. Einzelwelpen sind
hierbei stark im Nachteil, zeigen später oft Schwierigkeiten im Kontakt mit
Artgenossen und sollten nach Abgabe vom Züchter besonders häufig mit Welpen
interagieren und spielen dürfen, um Versäumtes aufzuholen. Aber auch bei
Welpen mit Geschwistern sind die Lernprozesse mit der 8. Woche bei weitem
nicht abgeschlossen, sondern müssen fortgeführt werden, idealerweise bis
über die Pubertät hinaus, in der sich dann oft entscheidet, ob der Hund
grundsätzlich verträglich bleibt, was bei zahlreichen positiven
Hundekontakten weit wahrscheinlicher ist. Sollte er dann ein gewisses
Problem meist mit gleichgeschlechtlichen Hunden entwickelt, ist das erst
mal nicht als Verhaltensstörung zu werten, auch etwas rasseabhängig und
eben auch von der Qualität der Beziehungen und Moderation der Hundekontakte
durch den Menschen abhängig. Sicher aber entstehen bei fehlenden
Sozialkontakten in den ersten Lebensmonaten besonders häufig
Unverträglichkeiten gegenüber Artgenossen, und einen unverträglichen
erwachsenen Hund zu haben, ist in unseren dicht besiedelten Lebensräumen
beileibe kein Spaß.
Welche
Lernerfahrungen sind nun also von Welpenspielgruppen zu erwarten:
• Die Beißhemmung wird entwickelt. Denn
die Hemmung, seinen Sozialpartner im Spiel oder bei Auseinandersetzungen
durch Zubeißen ernsthaft zu verletzen, ist nicht, wie vielfach behauptet
wird, angeboren, sondern muss im Spiel mit den Sozialpartnern erlernt werden.
Beißt der Welpe zu heftig, wird sein Gegenüber je nach Charakter und
Situation laut aufquieken, das Spiel abbrechen oder selbst wütend
zurückbeißen. So lernt der Welpe unmittelbar an den Folgen seines
Verhaltens, welcher Zahneinsatz noch angemessen ist.
• Eng damit zusammen hängt, dass der Welpe
so auch den angemessenen Umgang mit seinen angeborenen Aggressionen
erlernt. Denn um natürliches Aggressionsverhalten zu verfeinern, muss es
gezeigt werden können und der Hund muss lernen, es zu steuern und auch zu
unterbrechen. Auch wenn man gefrustet ist, stürzt man sich beispielsweise
nicht auf andere und mangelt sie nieder. Und oft reicht ein Knurren,
Zähnezeigen, Anrempeln, um die gewünschte Distanz zu einem Artgenossen
herzustellen.
• Der Welpe lernt, Frust zu ertragen und
sich zurückzunehmen. Wer sich im Spiel beispielsweise unfair verhält, indem
er zu stark zwickt, bekommt meist prompte Antwort. Also heißt es, sich
selbst zu zügeln und fair zu spielen. Oft kann man auch deutlich erkennen,
wie genervt ein Welpe ist, der seinen Spielpartner nicht fangen kann, und
wie der Frust in ihm wächst. Oder er ist das fünfte Rad am Wagen und
schafft es nicht, ins Spiel zweier anderer Welpen hineinzukommen. Meist
löst sich die Situation nach ertragbarer Zeit jedoch auf und auch der
gefrustete Welpe hat wieder Spaß und Erfolgserlebnisse. Auch wer
zwischendurch einfach mal nur zuschauen muss, ohne hinterher zu dürfen,
lernt mit Frust umzugehen. So eine Zwangspause ist für den kleinen
Welpenkörper ohnehin manchmal sinnig.
• Welpen lernen die Feinheiten der
Körpersprache auch anderer Rassen kennen. Denn nicht nur äußerlich
unterscheiden sich große, kleine, kurzschnäuzige, langschnäuzige, lang-,
woll- oder kurzhaarige stark, sondern auch vom Charakter und Spielverhalten
her. Während einer eher körperbetont rangelt, übt sich ein anderer bereits
als Welpe im Jagdspiel oder ist ganz sensibel und fein in der
Kommunikation. Gut ist es, wenn der Hund diese anfänglich als „Alien“
wahrgenommenen Wesen als Artgenosse erkennt, einschätzen kann und lernt,
auch sein Verhalten entsprechend anzupassen. Sonst kann es später leicht zu
körpersprachlichen Missverständnissen zwischen verschiedenen Hunderassen
kommen.
• Motorische und gesundheitliche Förderung
des Welpen. Freies Spielen mit anderen Hunden trainiert Muskulatur und
Koordination und fördert die Gehirnentwicklung. Die neuesten Erkenntnisse
der Gehirnforschung zeigen klare Zusammenhänge zwischen erhöhter körperlicher
Bewegung und erhöhter Hirnaktivität. Durch spielerische Bewegung werden die
verschiedenen Hirnareale für Wahrnehmung, Raumerfahrung, Körperbewusstsein,
Koordinationsvermögen und Gleichgewichtssinn angeregt und weiterentwickelt.
Bewegung fördert auch den Stoffwechsel und damit die Festigung der Knochen
sowie die Entwicklung von Muskeln und Organen. Komplexe Bewegungsabläufe
können nur durch wiederholtes Üben erlernt werden. Das ist an der Leine
beim reinen Spaziergang nicht möglich.
• Erproben und Einüben lebenswichtiger
Verhaltensweisen des Erwachsenenlebens. Im Spiel zeigt und vermischt der
Welpe all seine Funktionskreise: es wird Sexualverhalten genauso gezeigt
wie Jagdverhalten und Aggressionsverhalten. Der Welpe lernt jedoch mit der
Zeit, seine Funktionskreise klar zu trennen. Das ist besonders bei
Jagdverhalten und Aggressionsverhalten unerlässlich und beugt tragischen
Beißunfällen vor. Werden diese Verhaltensbereiche nicht durch Spiel in der
Welpenzeit sortiert und bleiben miteinander vermischt, resultieren daraus
Hunde, die ein kritisches Gefahrenpotenzial darstellen. Beißunfälle aus
fehlgeleitetem Beuteverhalten gegenüber Menschen und Hunden enden schnell
tragisch oder sogar tödlich.
• Der Welpe erlernt Bewältigungsstrategien
für schwierige Situationen. Denn manchmal bedeutet eine Welpengruppe auch
Stress für den Hund. Vielleicht steigt die Erregungslage mal zu stark an,
ein Spiel kippt oder es gibt Streit um eine Ressource. That’s life und
dafür gilt es, Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Doch diese fallen
nicht einfach vom Himmel, sondern müssen geprobt, angewendet und verfeinert
werden. So können auch unangenehme
Erfahrungen wertvoll sein, weil der Hund daraus etwas Sinnvolles lernen
kann. Z.B., dass ein Zähnefletschen auch ernst gemeint sein kann, aber es
möglich ist, durch deeskalierende Verhaltensweisen Konflikte zu
entschärfen. Er lernt sich aber auch mal zu behaupten und durchzusetzen.
• Der Welpe lernt, dass er sich in
Überforderungssituationen an seinen Besitzer wenden kann und dieser ihn
auch effektiv schützt. Aber auch, dass unangemessenes Sozialverhalten vom
Menschen nicht toleriert wird. Hier liegt die Gefahr von nicht fachgerecht geführten
Welpengruppen, in denen die Welpen völlig sich selbst überlassen bleiben.
Ein Welpe, der in einer unmoderierten Welpengruppe ständig die Erfahrung
macht, schwach zu sein und von seinen Artgenossen permanent
niedergetrampelt zu werden, entwickelt leicht Unsicherheiten und Ängste
gegenüber Artgenossen. Der Trainer sollte die Besitzer anleiten, ihre
Welpen gegebenenfalls zu schützen und auch selbst in eskalierende
Situationen eingreifen. Körperlich gefährlich wird dies auch bei stark
uneinheitlichen Größenverhältnissen. Und ein Welpe, der völlig ungehemmt
alles niedermobben kann, wird dies besonders gut lernen und auch später
noch zeigen. Hier ist ebenfalls der Mensch gefordert, Feedback zu geben und
Grenzen zu setzen. Also achtet unbedingt kritisch darauf, was der Trainer
zulässt und empfiehlt! Besser keine als eine schlecht geführte
Welpengruppe!
• Die Welpen lernen, ihre Angst zu
überwinden, das stärkt ihr Selbstbewusstsein. Denn Welpen sind wie kleine
Kinder unterschiedlich, der eine ein Draufgänger, sofort mittendrin im
Getümmel, der andere eher das zarte Pflänzchen, das sich alles erst mal vom
Rand aus ängstlich anschaut. Doch auch der Zurückhaltende kann in einer
guten Welpengruppe lernen, seine Angst vor dem Neuen zu überwinden,
vorsichtig Kontakt aufzunehmen und auch mal selbst beschnüffelt zu werden.
So wird der Hund mit der Zeit immer selbstbewusster und sicherer im Umgang
mit seinen Artgenossen.
Zugleich
entstehen tatsächlich Bindungen und Freundschaften zu anderen Hunden, was
die Lebensqualität erhöht.
• Bei souveränen älteren Hunden lernen die
Kleinen, dass nicht jeder Hund immer spielen will und welche
Beschwichtigungssignale wirksam sind, um einer Maßregelung zu entgehen.
Wichtig ist aber, dass der Welpenbesitzer die Sicherheit hat, dass diese
Hunde grundsätzlich freundlich sind und angemessen reagieren. Da es keinen
Welpenschutz gibt, ist das Kennenlernen von fremden erwachsenen Hunden
draußen auf der Spazierstrecke sehr kritisch zu betrachten. Dies kann in
einer Spielgruppe mit bekannten Hunden vermieden werden. Stark negative
Erfahrungen mit anderen Hunden in den ersten 4 – 5 Monaten beeinträchtigen
deren Vertrauen in Artgenossen nachhaltig und unter Umständen ein Leben
lang.
„Die
biologische Bedeutung des Spielens liegt in der Erprobung und Einübung
lebenswichtiger Verhaltensweisen des Erwachsenenlebens. Das Spielen ist
also eine Notwendigkeit, die der natürlichen Entwicklung des Hundes dient.“
(Weidt, 1996)
|
|
Der
Futterpunkt
Neben
dem richtigen Timing, der Wahl der passenden Belohnung, einem möglichst
fehlerfreien Übungsaufbau und klug geplanten Wiederholungen gibt es noch
einen weiteren Faktor, der über Erfolg im Hundetraining entscheidet: die
Wahl des passenden Futterpunktes / Belohnungspunktes, also WO / in welcher
Position der Hund seine Belohnung erhält.
Im
Clickertraining gibt es den Spruch „We click for action and feed for
position“.
Der
Marker für korrektes Verhalten (also Click oder eben unser Lobwort) kommt
bestenfalls im Training während der Handlung, und zwar dann, wenn der Hund
nichts mehr falsch machen kann, die Belohnung aber in der gewünschten
Endposition. Sollte der Hund die Endposition vor der Belohnung verlassen,
wird er zum Füttern konsequent wieder in diese verbracht, am besten mittels
Locken.
Soll
der Welpe also beispielsweise auf einen wackeligen Untergrund steigen, kann
ich ihn loben, wenn eine oder zwei Pfoten geschafft sind, gefüttert wird er
dann aber erst, wenn er ganz draufsteht. Das gilt besonders bei Hunden, die
noch etwas unsicher sind.
Möchte
ich meinem Hund Platz beibringen, kann ich ihn loben, wenn er sich gerade
hinlegt. Gefüttert sollte er immer erst in der ruhigen Platzposition
werden. Springt er gleich wieder auf und wird dann erst gefüttert, habe ich
im Grunde das Aufstehen belohnt und werde kaum einen ruhig, sicher und auch
länger liegenden Hund bekommen. Abzuraten ist auch aus diesem Grund davon,
den Hund während des Aufbaus eines sicheren Liegens / Sitzens aus dieser
Position abzurufen. Denn hier belohne ich immer automatisch nur das
Positionverlassen, das Herankommen, nicht aber das längere ruhige Sitzen
oder Liegen, welches lebhaften Hunden viel schwerer fällt als aufspringen
und zum Besitzer flitzen.
Hunde
tun das, was sich für sie lohnt, sie halten sich gerne dort auf, wo sie
häufig belohnt werden. Möchten wir einen leinenführigen, nah bei uns
gehenden Hund, macht es also Sinn, in ganz häufig nah an unserer Seite zu
füttern. Prellt unser Hund beim Bei-Fuß-Laufen gerne vor, kann ich dem
durch die Gabe der Leckerchen tendenziell hinter meiner Körperachse
entgegenwirken, während ich einen eher nachhängenden Hund etwas vor der
Körperachse füttere.
Auch
beim Herankommen des Hundes kann man sich überlegen, wo man seinen Hund am
liebsten haben möchte. Nach dem grundsätzlichen Aufbau eines zuverlässigen
Rückrufs kann es je nach Hund-Halter-Team und weiteren Zielsetzungen auch
Sinn machen, den Hund fürs Herankommen verbal oder mit Clicker zu loben,
das Futter aber erst zu reichen, nachdem man ihn damit in die Grundposition
eng an der linken Seite gelockt hat. Das kann durchaus Vorteile bringen,
z.B. wenn man häufig nach dem Heranrufen in dieser Position weiterlaufen
möchte oder um den Hund eben weg von der Position vor den Füßen zu haben
und selbst reibungsloser weiterlaufen zu können.
Bei
gewissen Übungen / Tricks etc. kann es aber auch herausfordernd bis hin zu
nicht möglich sein, den Futterpunkt korrekt zu wählen. Beim Trick „Hase“
(Sitzen und Vorderkörper mit Vorderpfoten in die Luft aufrichten) oder auch
beim „Männchen machen“ muss man natürlich schnell sein, um den Hund in der
Position zu bestätigen – es hilft aber, dem Hund eine immer längere Dauer
des Positionhaltens nahezubringen und eben, ihn exakt fürs
Gleichgewichthalten, das wir ja erreichen möchten, zu belohnen.
Beim
Apportieren von Gegenständen ist es schlicht nicht möglich, den Hund mit
Gegenstand im Maul zu füttern. Im Grunde wird man mit Futter hier immer das
Ausspucken / Auslassen des Gegenstandes bestätigen, weshalb es je nach Hund
hier auch mal sinnvoll sein kann, auf Futterbelohnung zu verzichten und dem
Hund mit der Stimme sehr überschwänglich verstehen zu geben, dass gerade
das längere Halten des Gegenstandes Lob einbringt.
Das
alles gilt natürlich auch bei Belohnung mit anderen Motivationsobjekten,
Spielzeug beispielsweise.
Im
Grunde klingt das alles ganz logisch – dennoch fällt es vielen Menschen
schwer, dies im Training exakt umzusetzen. Deshalb hilft es sehr, sich
dieses Prinzip vor jeder Trainingseinheit bewusst zu machen.
|
|
Die
Pubertät
–
dieser Anschluss ist vorübergehend nicht besetzt
Der
Eintritt in die Pubertät und die Dauer der Adoleszenz variiert individuell
und rasseabhängig. Beim kleinen Hund beginnt die Pubertät früher und die
Adoleszenz ist früher abgeschlossen. Ein Herdenschutzhund hingegen kann
schon mal drei Jahre brauchen, bis er wirklich erwachsen ist. Rüden sind
langsamer als Hündinnen. Im Grunde ist Pubertät der Teil der Adoleszenz, in
welchem die Geschlechtsreife erreicht wird. Schwierig ist diese Zeit
oftmals, weil sich die Prioritäten des eben noch so unkomplizierten und
anhänglichen Welpen nun komplett verschieben. Er wird selbstständiger und
zeigt ein gesteigertes Erkundungsverhalten. Selbstbelohnendes Verhalten
bekommt einen größeren Stellenwert, jede Schnupperstelle ist für den Hund
phasenweise interessanter als der Halter. Dem Hund fällt es schwer, sich
von für ihn wichtigen und lohnenswerten Dingen zu trennen und sich
stattdessen auf seinen Besitzer zu konzentrieren. Ressourcen bzw. deren
Verteidigung werden ebenfalls auf einmal wichtig.
Die
Veränderungen im Verhalten sind ein physiologisch völlig normaler Ablauf.
Der Hund benimmt sich keinesfalls so, um seinen Halter zu ärgern! Trotzdem
darf „falsches“ Benehmen nicht geduldet werden. Konsequenz, Sicherheit,
Orientierung und Führung braucht der Hund nun mehr denn je. Wenn man den
Dingen ihren Lauf lässt, verfestigen diese sich und wachsen zu immer
größeren Problemen heran.
Informationen,
Wissen, Können und Fähigkeiten, die in der Welpen- und Junghundezeit
wichtig waren, werden jetzt grundlegend auf den Prüfstand gestellt, um zu
testen, ob sie auch jetzt und im zukünftigen Erwachsenendasein noch
Bedeutung haben. Was in diesem Zeitraum nicht bestätigt wird, wird also
vergessen. Weil aber die neuen Verknüpfungen oft erst aufgebaut werden,
nachdem die alten gelockert sind, ist buchstäblich eine lange Leitung, ein
verzögertes Verständnis, ein gestörtes Erinnerungsvermögen und anderes
Verhalten in dieser Zeit zu erwarten und auch nachweisbar. „Das hat er ja
noch nie gemacht“ wird zum Standardspruch des Hundebesitzers in den
nächsten Monaten (oder sogar Jahren) – und stimmt hier sogar einmal. Wenn
wir gestern noch einen kleinen Streber unser eigen nannten, haben wir jetzt
ein Pubertier an der Leine. Und mit ihm ist über Nacht der „Was war ‚Komm
her‘ gleich wieder“-Blick aufgetaucht. Wut auf den ignoranten Hund ist zwar
verständlich, hilft aber nicht weiter. Geduld und Verständnis sind wichtig,
auch wenn das leichter geschrieben als getan ist.
Der
Stresshormonspiegel ist bei allen Säugetieren während der Phase des
Heranwachsens am höchsten. Durch geänderte Konzentrationen nicht nur der
Sexualhormone, sondern auch von Schilddrüsenhormon, Nervenwachstumsfaktor
und Cortisol werden die Verhältnisse im Gehirn völlig »aufgemischt«. Zellen
und Verknüpfungen im Gehirn werden abgebaut und später durch andere,
schnellere und leistungsfähigere Verbindungsstrecken ersetzt. Sexualhormone
und Cortisol zusammen bilden, wie man z. B. aus Untersuchungen von Aggressionsauffälligkeiten
bei pubertierenden Mädchen weiß, eine ausgesprochen explosive Mischung. In
der Pubertät steigt durch diesen Hormoncocktail die Risikobereitschaft,
also die Bereitschaft, auch potenziell gefährliche Dinge zu tun, ohne
Rücksicht auf Konsequenzen. Genau dieses Phänomen kennt man auch von
menschlichen Pubertierenden. Die Sexualhormone, speziell Testosteron, aber
auch Östrogene ihrerseits, steigern die Emotionalität, erhöhen bisweilen
auch den Spiegel des „Kampfhormons“ Noradrenalin.
Infolge
der Veränderungen im Gehirn sind Impulskontrolle und Risikoabschätzung
nicht unbedingt die Stärke pubertierender Junghunde. Der Junghund reagiert
empfindlicher und intensiver auf Reize aus der Umwelt. Dies bedeutet, dass
Reaktionen emotionaler ausfallen als bisher. Dies ist leider auch ein guter
Nährboden für Aggressionen. Besonders Rüden testen schon mal ihren
Marktwert beim Zusammentreffen mit anderen Rüden; in den so genannten
Kommentkämpfen geht es dann mitunter sehr laut und aggressiv zu, bis einer
signalisiert "Ok, ich gebe auf, du bist der Stärkere". Das ist
normales Halbstarken-Verhalten und sollte sich nach den ersten zwei bis
drei Lebensjahren wieder legen. In den allermeisten Fällen ist die Rauferei
harmlos und die Hunde tragen keine Verletzungen davon, auch wenn dem
Besitzer angst und bange beim Zusehen wird. In der Regel gilt: Je lauter es
zugeht, desto ungefährlicher. Derartige Erfahrungen im Junghund-Alter
fördern das angemessene soziale und respektvolle Verhalten bei späteren
Auseinandersetzungen. Hundekontakte nun zu meiden, ist also der falsche
Weg. Besonders ein souveränes hundliches Gegenüber, das in dieser Phase
eindeutige Abbruchsignale und Grenzen setzt, ist dieser Entwicklung
förderlich. Allerdings sollten Hundehalter die Kommentkämpfe genau
beobachten. Denn natürlich können sich Schaukämpfe auch zu ernsteren
Auseinandersetzungen entwickeln. Dazu kommt es jedoch eher bei Jungrüden,
die sich unbekannt sind. Im Beisein einer deckbereiten Hündin kann es aber
auch zwischen »Kumpeln« zu ernsthaften Streitigkeiten kommen.
Auch
Hündinnen werden zickiger zu Artgenossen, finden Welpen und Junghunde
vielleicht plötzlich ziemlich doof. Vorsicht ist geboten bei
Hündinnenraufereien, denn diese sind zwar seltener, aber dann ernsthafter
und oft auch schnell ziemlich blutig, geht es doch um die Verteidigung des
eigenen (auch fiktiven) Nachwuchses.
Bei
Fehlverhalten dem Mensch gegenüber ist es essentiell, Grenzen aufzuzeigen
und durch Abbruchsignale und andere unmissverständliche
Kommunikationsschritte die Handlungen des Pubertierenden einzuschränken. So
erfolgt schnell eine gesellschaftsverträgliche Anpassung. Wichtig ist dabei
jedoch, dass diese genannten Verhaltensabbrüche immer in einem positiven
Zusammenhang, z. B. durch nachfolgende Spielhandlungen, wieder
Freundlichsein, beendet werden müssen. Rein negatives Unterdrücken durch
aversive Einwirkungen oder auch Ignorieren ist hier der falsche Weg. Es
bleibt bei der Regel, dass Strafe die Ausnahme und Lob die Regel sein muss.
Wirklich
erwachsen ist der Hund dann wohl erst etwa nach vollständigem Durchlaufen
des 3. Läufigkeitszyklus der Hündin (Rüden entwickeln sich ähnlich schnell,
also kann dieser Richtwert auch für sie übernommen werden), also frühestens
mit 1 ½ Jahren, große Rassen auch oft deutlich später. Wird bereits vor
oder während dieser Zeit kastriert, so fehlen die genannten chemischen
Einflüsse der und Entwicklungen durch die verschiedenen Hormonsysteme, und
das Tier bleibt sein Leben lang jugendlich bis unkontrolliert kindsköpfig.
Die
Pubertät ist auch bei Hundeartigen derjenige lebensgeschichtliche
Zeitabschnitt, in dem über die zukünftige Abwanderung aus dem Rudel
entschieden wird. Die Entscheidung, in einem Familienverband zu verbleiben
oder diesen zu verlassen, ist wesentlich abhängig von den sozialen Signalen
und Mechanismen, die von den ranghohen und älteren Gruppenmitgliedern
eingesetzt werden. Wird Hunden in dieser Situation gezeigt, dass sie im
Verband nicht willkommen sind, bereiten sie sich innerlich ebenso auf die
Abwanderung vor, wie umgekehrt Hunde, die erkennen, dass sie von den
Leitindividuen gegenüber den Kindern bzw. Jugendlichen bevorzugt werden,
sich daraus eine privilegierte Stellung, gegebenenfalls auch auf Kosten der
heranwachsenden menschlichen Mitglieder, sichern wollen. Es ist also
Fingerspitzengefühl und genaues Hinschauen auf die einzelnen Beziehungen im
Hund-Mensch-Verband erforderlich, um rechtzeitig gegensteuern zu können.
Grundsätzlich
hilfreich in der Pubertät ist es, bewältigbare Anforderungen an den Hund zu
stellen. Ob das im Training der bekannten Hundesportarten liegen soll, im
Beibringen von Tricks oder einem Mischmasch aus Nasenarbeit, Agility,
Obedience etc. ist völlig egal. Dann braucht er sich auch keine
unerwünschten Ersatzbeschäftigungen zu suchen, mit denen er sich selbst
seiner Stärke vergewissern will. Die plötzlich erwachenden Wach- und
Schutzbestrebungen des Hundes sollte man nicht als lästigen und peinlichen
Aspekt werten, sondern als Ausdruck normalen Hundeverhaltens und versuchen,
sie zu kanalisieren. Erstes Melden wird mit einem "Fein
aufgepasst" verbal belohnt, es gibt ein Leckerchen, dann fordert man
ein alternatives Verhalten, das mit Bellen unvereinbar ist.
Das
erzieherische Vorgehen des Hundebesitzers ist in der Pubertätsphase eine
Gratwanderung von Ignoranz, Toleranz und Konsequenz. Es hilft, sich in die
Gedankenwelt des Hundes einzufühlen, ruhig und konsequent ohne Wutausbrüche
dabeizubleiben, dass der Hund Ge- und Verbote zu beachten hat, Humor zu
beweisen und ihn - im übertragenen Sinne - an langer Leine zu führen. Das
bedeutet konkret im Alltag: Wenn der Hund bislang ein folgsamer Begleiter
gewesen ist und gut im Familienrudel eingeordnet gewesen ist, sollte man
nicht an sich und den bisherigen Erziehungsbestrebungen verzweifeln.
Positives Denken ist der erste Schritt zu positiver Problemlösung. Hat der
Hund jedoch bislang auch schon nie so richtig "funktioniert", hat
sich immer schon kleinere Frechheiten herausgenommen und demonstriert, dass
Mensch ihm nichts zu sagen hat, was jetzt nur extensiv gesteigert wird,
dann sollten man sich darüber im Klaren sein, dass es jetzt fünf vor zwölf
ist und gegebenenfalls fachkundige Hilfe holen.
Im
Normalfall ist aber die hundliche wie auch menschliche Pubertät eine
natürliche, oft nervenaufreibende, aber ganz sicher vorübergehende Phase,
die gemeinsam mit dem Vierbeiner überstanden werden muss.
|
Haftungsausschluss
Impressum
Datenschutzerklärung
|